 |
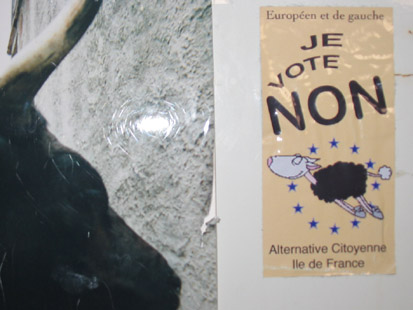 |
Nein zur EU-Verfassung
Das NON triumphiert. An der extremen Rechten liegt es nicht.
Frankreich hat zu 55 Prozent "Non" zur Ratifizierung des "Verfassung" genannten Staatsvertrags der EU gesagt. Ein Ergebnis, das nach den Umfragen der letzten Wochen durchaus erwartet kam, aber in seiner Deutlichkeit dann doch leicht überraschte.
An der extremen Rechten hat es definitiv nicht gelegen, auch wenn ihr Gespenst im Abstimmungswahlkampf vor allem von den Befürwortern des Vertragswerks beständig beschworen worden war. Seit Wochen war das Argument zu einer veritablen moralischen Erpressung der linken oder linksliberalen Wähler benutzt worden: "Wenn Ihr mit Nein abstimmt, dann stimmt Ihr wie Le Pen." Dabei verschwiegen die Mehrheitssozialdemokraten, die dieses Argument hauptsächlich einsetzten - auch gegen ihre eigene Parteilinke - wohlweislich, dass eine Ja-Stimme ihrerseits identisch mit der Position eines Silvio Berlusconi zum Verfassungsver- trag war. Oder jener des italienischen "Postfaschisten" Gianfranco Fini, der als Mitglied des so genannten Verfassungskonvents sogar Co-Autor des Vertragswerks war.
Den rechtsextremen Front National würden derzeit rund neun Prozent
der Franzosen wählen. Der Vorsprung des NON gegenüber dem OUI
bei der Abstimmung beträgt aber gut 10 Prozent. Demnach hätten
die Kritiker des Verfassungsvertrags auch dann noch die Abstimmung gewonnen,
wenn am Sonntag alle Le Pen-Anhänger durch eine rätselhafte Krankheit
befallen worden wären und mit einer plötzlichen Lähmung
hätten zu Hause bleiben müssen. Der Sieg des NON ist also nicht
der extremen Rechten zu verdanken.
Soziale Polarisierung
Unbestreitbar ist die soziale Polarisierung, die dem Votum vom Sonntag
zugrunde liegt. (Je nach Umfrage) 75 bis 81 Prozent der Industriearbeiter
und 79 Prozent der Erwerbslosen stimmten gegen die Annahme des Verfassungsvertrag.
Hingegen votierten vier Fünftel der leitenden Angestellten und Manager
mit "Ja", das ansonsten nur unter höheren Angestellten, Unternehmern
und Selbständigen in der Mehrheit war. Und bei den über 60jährigen,
für die ein Votum über den vorgeschlagenen Verfassungsvertrag
oftmals subjektiv gleichbedeutend mit einem Votum "für Europa" und
damit "für den Frieden nach 1945" war.
 |
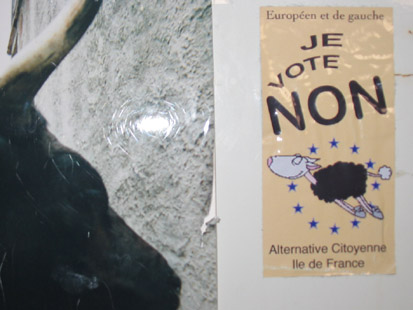 |
Wenn in der, von ihren "kleinen Leuten" aufgrund der Mietpreisentwicklung der letzten 30 Jahre größerenteils "gesäuberten" Hauptstadt Paris 66 Prozent der WählerInnen mit "Ja" stimmen (80 Prozent im großbürgerlichen 16. Arrondissement) und in den nördlich angrenzenden Trabantenstädten weit über 60 Prozent mit "Nein", dann ist dies ein deutliches Signal. So stimmten in der KP-regierten Bezirkshauptstadt des nördlich an Paris angrenzen Départements Seine-Saint-Denis, in Bobigny, 72 Prozent mit Nein. In diese Banlieue-Zone hat Paris in den letzten drei Jahrzehnten einen Großteil seiner armen Familien, "kleinen Leute" und Lohnabhängigen , die sich nur hier noch eine Wohnung leisten können, abgeschoben.
Mehrheitlich mit "Ja" stimmten nur die traditionell durch eine christdemokratische und "pro-europäische" politische Tradition geprägten Regionen Bretagne und Elsass (62,9 Prozent in Strasbourg). Die dritte von insgesamt 22 französischen Regionen auf dem Kontinent, die mit knapper Mehrheit mit "Ja" stimmte, war die Region Ile-de-France (rund um die französische Hauptstadt). Aber dies nur dank des mehrheitlichen Pro-Verfassungsvertrag-Votums der Hauptstadt Paris zählt 2,1 Millionen Einwohner, der Ballungsraum insgesamt 8 bis 9 Millionen sowie des bürgerlich-wohlhabenden Nachbarbezirks rund um Versailles. Dagegen stimmten die übrigen Vororte und Trabantenstädte von Paris größtenteils mit deutlichen Mehrheiten für das "Nein" (siehe oben).
Alle anderen der 22 französischen Regionen auf dem Kontinent stimmten mit "Non". Anders sieht es in den Überseeterritorien wie den Antilleninseln und Guyana aus, wo das "Ja" über 60 Prozent erhielt. Aber diese Einheiten hängen wirtschaftlich heute weitgehend von Transferzahlungen der "Metropole" sowie der EU ab, und Chirac persönlich hatte ihnen signalisiert, dass sie auf keinen Fall falsch abstimmen sollten.
Mit "Oui" stimmten frankreichweit vorwiegend die bürgerlichen Innenstädte. Aus ähnlichen Gründen wie Paris stimmte Lyon, wo ebenfalls das Banlieue-Phänomen existiert, für das "Ja". Dagegen stimmte die drittgrößte Stadt des Landes, Marseille, die noch weitaus eher eine Kleine-Leute-Metropole geblieben ist, zu 63 Prozent mit Nein.
Die letzte französische Stadt mit über 100.000 Einwohnern,
die durch die KP regiert wird, das nordfranzösische Calais, stimmte
mit 74 Prozent für das "Non".

Ein "Nein" wogegen?
Sicherlich sind europapolitische Entscheidungen komplexer Natur, da
unterschiedliche, ja gegensätzliche Motive sich in einer gemeinsamen
Ablehnung oder Zu- stimmung bündeln können und dies
nicht nur in Frankreich. Man kann die politische Grundkonstellation als
eine Art Koordinatenkreuz darstellen: Auf der einen Achse steht "Mehr nationale
Souveränität oder mehr europäische Integration". Auf dieser
Ebene ist die Opposition von rechts gegen das supranationale Europa, oder
"zu viel" davon, angesiedelt. Der CSU-Abgeordnete Peter Gauweiler steht
ebenso für eine solcherart motivierte Ablehnung wie die britische
United Kingdom Independance Party (UKIP), die bei zu den Gewinnern der
letzten Europaparlamentswahlen zählte, oder die Franzosen Jean-Marie
Le Pen und Philippe de Villiers.
Doch zu einem richtigen Koordinatenkreuz gehört noch eine zweite
Achse, die quer zur anderen liegt, und auf der steht: "Wirtschaftsliberales
oder soziales Europa". Es ist diese Dimension, die am Abstimmungssonntag
in Frankreich abstimmungsentscheidend war. Die Anhänger der Rückkehr
zur nationalstaatlichen Souveränität erschienen im zurückliegenden
Wahlkampf vorwiegend als Vertreter eines Anachronismus. Sie schlugen vor,
in einen Zug einzusteigen, der längst nicht mehr auf dem Fahrplan
steht: Seit dem Euro gibt es keine nationale Währungspolitik mehr,
die Osterweiterung der EU wird auch durch das Ergebnis des Volksentscheids
vom Sonntag nicht rückgängig gemacht werden. Tatsächlich
drehte sich die Debatte der letzten Woche kaum darum, ob man einen Schritt
hinter diese Entwicklung zurück machen möchte, sondern vor allem
darum, was man mit dem politischen Raum jetzt anfangen will, der in großen
Teilen des Kontinents entstanden ist.
Was der "Verfassung" genannte Staatsvertrag dazu vorschlug, konnte die
Mehrheit der französischen Wähler nicht befriedigen. Soziale
Probleme und individuelle politische Rechte sollen weiterhin den Nationalstaaten
überlassen bleiben, und nur der Markt und die Konkurrenz sollten die
Bevölkerungen der EU miteinander verbinden: In seinem Artikel III-210-2
schloss der Verfassungsvertrag explizit eine Angleichung der sozialpolitischen
Gesetzgebung der verschiedenen EU-Länder aus, eine "Harmonisierung"
auf diesem Gebiet soll allein einer vermeintlichen spontanen Entwicklung
der Gesetzgebungen auf jeweils nationaler Ebene überlassen bleiben.
Und bei den Bürgerrechten bringt der Vertrag denen, die beispielsweise
noch immer kein Recht auf Ehescheidung oder Abtreibung haben - in Polen,
Portugal, Irland oder Malta - keinerlei Fortschritt. Gesellschafts- und
Sozialpolitik im nationalen Rahmen, überwölbt von einem transnationalen
Markt: Nein, dieses Europa wollten die Franzosen mehrheitlich nicht.
 |
Jetzt kommt es darauf an, was man daraus macht
Und auch andernorts träumen Menschen von etwas Anderem als nackter Konkurrenz, wenn sie an grenzüberschreitende Solidarität denken. Spät in der Wahlnacht rief der Österreicher Leo Grabriel vom Austrian Social Forum auf der Place de la Bastille aus: "Merci, La France!" Und informierte das versammelte Publikum - Mitglieder der KP, der radikalen Linken und Basisgewerkschafter - darüber, dass am selben Abend spontan Menschen in Wien, in Berlin oder in belgischen Städten auf die Straße gingen und vor die französischen Botschaften zogen, um das Non zu feiern. Zahlreiche Linke, Gewerkschafter und Attac-Menschen aus anderen EU-Ländern waren zuvor nach Frankreich gekommen, um zu sagen: "Euer Nein ist unser aller Nein." Am 3. April beispielsweise hatte die französische KP Gastredner aus allen Mitgliedsländern der EU, aber auch aus einem Beitrittsland wie Bulgarien in ihrer Pariser Parteizentrale an der Place du Colonien Fabien versammelt, in Zusammenarbeit mit der deutschen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch andere Vertragsgegner betrieben einen gemeinsamen Wahlkampf mit ihren europäischen Pendants, so war am vorletzten Tag vor der Abstimmung Oskar Lafontaine bei den linkssozialdemokratischen Opponenten des Verfassungsvertrags zu Gast in Paris.
Daran gilt es jetzt anzuknüpfen, wenn das Ereignis vom Sonntag nicht auf einen kurzatmigen Wahltagstriumph beschränkt bleiben soll. Die britische Ratspräsident- schaft der EU im zweiten Halbjahr 2005 wird zweifellos versuchen, eine andere Lehre aus dem Nein zu ziehen: Zu viel politische Integration ist ohnehin schädlich, beschränken wir die Union auf einen großen Markt, dann geht es auch ohne "Verfassung". Dem gilt es entgegen zu steuern: Wenn jene, die sozial und wirtschafts- politische Kritik an dem Vertragswerk übten, sich jetzt auf dem Ergebnis ausruhen und nichts unternehmen sollten, dann wird das von ihnen Befürchtete zweifellos auf anderem Wege Wirklichkeit werden. Denn auch ohne Verfassungsvertrag könnte es ein neoliberales Europa geben - nein, es existiert bereits jetzt.
Das französische Votum ist auch Ausdruck einer ungebetenen "Einmischung" in die "große Politik": Die Stimmbeteiligung war vor allem auch in Arbeiter- und Unterschichtsbezirken so hoch wie seit 20 Jahren bei fast keiner Wahl, und vor allem bei keiner Europaparlamentswahl. Das Europathema sollte den vermeintlichen Experten überlassen bleiben, die für Nichtjuristen schwer lesbare Verfassungstexte entwerfen oder exegieren können, die Debatte in den bürgerlichen Medien monopolisierten und alle Einwände auf den Nenner des Rechtspopulismus zu bringen versuchten. Am Sonntag wurden sie Lügen gestraft. Aber diese Einmischung sollte andauern, und nicht nur in Frankreich.
(Bernhard Schmid, Paris)