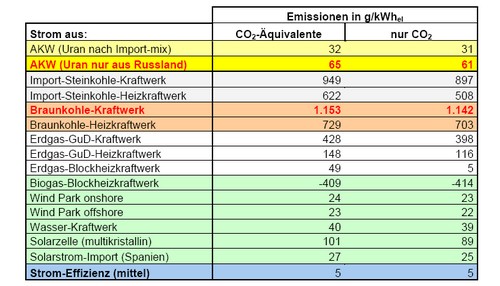Austermanns Energiepolitik:
Kohle um jeden Preis
Wie berichtet, planen E.on und die Stadtwerke, d.h. deren
Mehrheitsaktionär MVV, auf dem Gelände des Gemeinschaftskraftwerks
Ost direkt an der Förde in Dietrichsdorf den Neubau eines 800 Megawatt
Steinkohlekraftwerks. Nun hat das Bündnis Kielwasser eingeladen, um
gegen diese klimaschädlichen Kohlepläne eine Bürgerinitiative
zu gründen. Man trifft sich am Montag dem 13. August um 19 Uhr in
der Pumpe.
Steinkohle ist nach der Braunkohle die für das Klima
ungünstigste Methode der Stromerzeugung, weil bei ihrer Verbrennung
große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) entstehen. Doch
während alles von Klimawandel spricht planen Stromkonzerne wie E.on,
RWE, Vattenfall und andere den Bau zahlreicher neuer Kohlekraftwerke. Bundesweit
hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Planungen für insgesamt
26 neue Braun- und Steinkohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 26.000
MW gezählt. Hintergrund ist die Tatsache, dass in den nächsten
14 Jahren die deutschen AKWs nach und nach abgeschaltet werden, die derzeit
26 Prozent des Strombedarfs liefern, und dass darüber hinaus auch
viele Kohlekraftwerke ersetzt werden müssen, weil sie zu alt werden.
Die Frage ist allerdings, ob sie wirklich durch Kohlekraftwerke ersetzt
werden müssen. Der Landeswirtschaftsminister Dieter Austermann sagt
bedingungslos Ja. Anfang des Sommers legte er ein „Grünbuch Schleswig-Holstein
Energie 2020“ vor, dass es in sich hat. Von derzeit 4,3 Millionen will
er bis zum Jahre 2020 den Kohlendioxid-Ausstoß der Stromwirtschaft
im Land auf 15 Millionen Tonnen steigern. In Schleswig-Holstein sind vier
neue Kohlekraftwerke im Gespräch: Eines in Kiel und drei weitere im
Raum Brunsbüttel.
Vorgeschobene Argumente
Und so sehen die Vorstellungen des CDU-Ministers aus:
Die jährliche Stromerzeugung soll in Schleswig-
Holstein bis 2020 von derzeit 35 Terawattsunden (TWh,
eine TWh entspricht einer Milliarden Kilowatt-
stunden) auf 44 TWh wachsen, die im Wesentlichen je zur
Hälfte mit Kohle und Wind gewonnen werden. Gleichzeitig soll der Verbrauch
trotz eher rückläufiger Einwohnerzahlen von 13,5 TWh auf bis
zu 16 TWh zunehmen. Effizienzsteigerung ist für den Wirtschaftsminister
offensichtlich ein Fremdwort.
Die Zunahme des Windstroms ist begrüßenswert,
erfordert aber gewisse Umsettlungen im Netz und im Rest der Stromproduktion.
Der Wind weht bekannter Maßen unstet, sodass die elektrische Energie
zu Zeiten anfallen kann, in denen es wenig Bedarf gibt, während zu
Spitzenbedarfzeiten Flaute herrschen mag. Deshalb kann Schleswig-Holstein
seinen Strombedarf sicherlich nicht vollständig aus heimischen Windstrom
decken, selbst wenn übers Jahr mehr produziert als verbraucht wird.
Dem Problem kann auf dreierlei Weise begegnet werden:
a) durch großräumigen Verbund vom Atlantik bis zur Ostsee, denn
irgendwo weht es immer; b) durch Speicherung (Pumpspeicherwerke, Druckluftspeicher
in Tavernen etc.); c) durch Kraftwerke aller Art, die einspringen, wenn
es nicht weht. Das Realistischste ist sicherlich eine Mischung aus allen
drei Elementen, doch Austermann setzt allein auf c. Sein „Grünbuch“
hält sich entsprechend nicht lange mit Lösungsmöglichkeiten
a und b auf. Weder Speicheroptionen noch Möglichkeiten, die der Netzverbund
bietet, werden ernsthaft erörtert, geschweige denn, dass Entwicklungs-
pfade beschrieben würden, mit denen entsprechende
Lösungen aufzubauen wären.
|
CO2-Emissionen in Gramm pro
Kilowattstunde
|
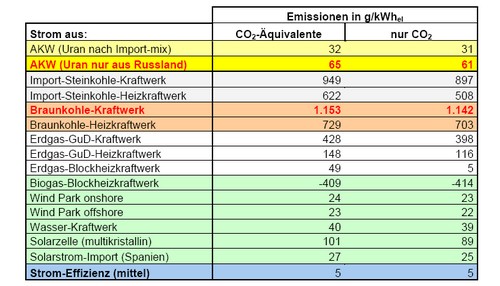
|
| Erläuterungen:
GuD-Kraftwerk = Gas- und Dampfturbinenkraftwerk.
Im Falle der verschiedenen aufgeführten Heizkraftwerkstypen
wurden die durch die Fern- bzw. Nahwärme vermiedenen Emissionen in
Heizungsanlagen in den Haushalten und öffentlichen Gebäuden von
den Emissionen des Kraftwerks abgezogen. Für alle Anlagentypen wurden
die Emissionen aus Bau sowie Aufbereitung und Transport der Kraftstoffe
etc. berücksichtigt. Bei den Gaskraftwerken fällt ins Gewicht,
dass ein Teil des methanhaltigen Gases in die Atmosphäre entweichen
kann. Deshalb ist zum Beispiel bei einem Biogaskraftwerk die Gesamtbilanz
etwas schlechter als die reine CO2-Bilanz, denn Methan ist ebenfalls ein
Treibhausgas, und zwar eines, das noch wesentlich effektiver als CO2 ist.
Man beachte, dass kleine Blockheizkraftwerke geringere spezifische Emissionen
haben als Atomkraftwerke. Quelle: Fritsche, Uwe R., 2007: Treibhausgasemissionen
und Vermeidungskosten der nuklearen, fossilen und erneuerbaren Strombereitstellung
- Arbeitspapier. Öko-Institut e.V. Darmstadt. |
Beispiel Dänemark
Doch auch wenn man neue Kraftwerke baut gäbe es mehr
Möglichkeiten, als Großkraftwerke in die Landschaft zu setzen.
Das zeigt das Beispiel Dänemark. Noch Mitte der 1990er Jahre wurde
beim nördlichen Nachbarn rund 80 Prozent des Stroms in Kohlekraftwerken
produziert, obwohl das Land schon damals ein Pionier in Sachen Windenergie
und Kraftwärmekopplung (KWK) war. Doch 1996 zog die Regierung aufgrund
des drohenden Klimawandels die Notbremse und untersagte den Bau neuer Kohle-
kraftwerke. 2006 war der Beitrag der großen Zentralkraftwerke
an der Stromerzeugung, die teils mit Kohle, teils mit Erdgas betrieben
werden, auf knapp 56 Prozent gesunken. Kleine dezentrale Heizkraftwerke,
die oft mit Biomasse betrieben werden, liefern rund 24 Prozent des Stroms,
die Windenergie leistet etwa 20 Prozent.
In Dänemark wird heute ganz auf Dezentralisierung
gesetzt, auch wenn die derzeit regierenden Rechtsliberalen, die sich von
der extrem rassistischen Volkspartei tolerieren lassen, den Ausbau neuer
Offshore-Parks behindert. Die Energielandschaft ist in Jütland und
auf den Inseln durch eine Vielzahl kleiner Anlagen und einigen ganz wenigen
verbliebenen Großkraftwerken geprägt. Möglich wurde das
unter anderem auch durch die Verstaatlichung des Netzes. Damit wurde eine
von den Erzeugern unabhängige und nicht vornehmlich gewinnorientierte
Instanz geschaffen, die durch ein modernes Kommunikationsnetz mit den Betreibern
verbunden ist. Energienet.dk verknüpft in ihrer Leitstelle Windvorhersagen,
Verbrauchs-
prognosen und Informationen der Erzeuger, berücksichtigt
auch noch die Entwicklung der Strombörse und koordiniert den Austausch
über den Stromverbund mit den skandinavischen Nachbarn und mit Deutschland.
Doch von einer derartigen intelligenten Lösung scheint
man in der Kieler Landesregierung noch nichts gehört zu haben. Das
„Grünbuch“ vermeidet jedenfalls die Erwähnung der dänischen
Erfahrungen weitgehend und handelt sie in einer Fußnote lapidar ab:
„Ein Vergleich mit der hohen KWK-Durchdringung Dänemarks liegt neben
der Sache, weil dort die entsprechenden Entscheidungen bereits ab den 1980er
Jahren umgesetzt wurden. Eine generelle Übertragung auf Deutschland
verkennt die zwischenzeitlich manifeste Unterschiede, was man zwar beklagen,
aber nicht mehr ändern kann.“ Mit anderen Worten: Weil seinerzeit
hierzulande auf Atomkraft gesetzt wurde und man nicht die schon damals
als Alternative geforderten Kleinkraftwerke gebaut hat, deren Abwärme
zugleich zum Heizen genutzt werden kann, ist jetzt eben nichts mehr zu
machen. Eine wirklich umwerfende Logik.
Mit der gleichen Schnoddrigkeit werden andere Alternativen
übergangen, wie der Bau moderner Gas- und Dampfturbinenkraftwerke,
die wesentlich geringere spezifische CO2-Emissionen verursachen. Diese
könnten sowohl mit Erdgas als auch mit gereinigtem Biogas aus der
Vergärung von landwirtschaftlichen Abfällen betrieben werden,
was sie besonders attraktiv macht. Zudem sind sie auch noch wesentlich
flexibler zu steuern als Kohlekraftwerke und würden sich daher auch
vom rein netz-technischen Standpunkt besser eignen, um die Windkraft abzufedern.
Vermutlich wären sie auch in Kiel die beste Alternative, wenn das
Gemeinschaftskraftwerk Ost einmal ersetzt werden muss. Tabelle 1 zeigt
einen Vergleich der spezifisch Treibhausgasemissionen verschiedener Kraftwerkstypen.
Die Zahlen zeigen anschaulich, dass die sinnvollste Variante kleine Einheiten
sind, bei denen sich auch die Wärme nutzen lässt.
Bemerkenwertes Demokratieverständnis
Das „Grünbuch“, so Austermann bei dessen Vorstellung
in einer Presseerklärung, soll in den kommenden Monaten als
Diskussions- grundlage dienen, an dessen Ende energiepolitischen
Leitlinien des Landes-
kabinetts stehen sollen. Bezeichnend für seine Vorstellungen
von diesem Meinungsbildungsprzess ist die Ankündigung, bereits im
August die „Entscheidungsträger der Energiebranche Schleswig-
Holsteins einladen“ zu wollen, „um über die ökologischen, wirtschaftlichen
und politischen Konsequenzen aus der Expertise zu beraten.“ Mit anderen
Worten: Der Kieler Wirtschaftsminister möchte gerne in kleiner Kungelrunde
die Konzernlenker die Weichen für die nächsten Jahrzehnte stellen
lassen. Der Eindruck wird verstärkt durch die Tatsache, dass die „Entscheidungsträger“
der einzige Personenkreis sind, dessen Einbeziehung in die Diskussion der
Landesregierung erwähnt wird. Eine andere Frage ist allerdings, ob
Unmweltverbände, Gewerkschaften und andere sich dieses sehr eigene
Demokratieverständnis gefallen lassen.
(wop)